Woche 1: vom 01.12.2025 bis 07.12.2025 > HIER
Woche 2: vom 08.12.2025 bis 14.12.2025 > HIER
Woche 3: vom 15.12.2025 bis 21.12.2025 > HIER
Woche 4: vom 22.12.2025 bis 24.12.2025 > HIER
Die Geschichte des Network-Marketings: Network-Marketing ist eigentlich die Geschichte eines Traums: „Mit Menschen reden, Produkte empfehlen, ein Netzwerk aufbauen – und damit ein eigenes Business starten.“ Doch wie so oft liegt zwischen Traum, Realität und Abgrund nur ein schmaler Grat.
Hier folgen nun in dem "Rat des Tages" im Laufe der nächsten Tage dieser Woche eine Reihe von Tipps, wie diese Branche zu meistern ist..
Montag, der 8. Dezember
Tages-Motto: "Jeder Tag im Dezember bringt neue Chancen, Liebe zu schenken und Freude in kleinen Momenten zu entdecken." ( von Unbekannt )
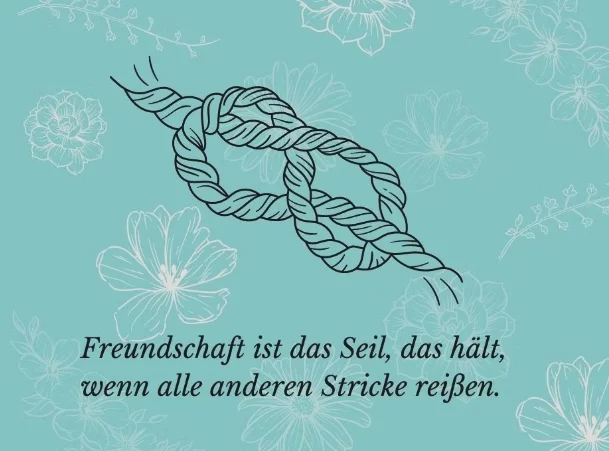
Top Tipps für Network
Marketing!
Tipp 1: Wähle ein seriöses Unternehmen und Produkt
Morgen > Tipp 2: Baue eine starke persönliche Marke auf
Der 8. Dezember 2025 hat international vor allem religiöse, kulturelle und einige „kuriose“ Bedeutungen, ist aber kein offizieller UN‑Welttag wie etwa der 10. Dezember (Tag der Menschenrechte). Wichtig sind insbesondere der katholische Feiertag „Unbefleckte Empfängnis“ und der buddhistische Erleuchtungstag (Bodhi Day), dazu kommen diverse inoffizielle Gedenk- und Aktionstage.
Der Link des Tages: https://www.linkedin.com/groups/6860908/ (Jutta P. - HPP - ORGA-Leitung ) ...
Diese Gruppe ist dafür
konzipiert, etwas anderes ihren Mitgliedern zu bieten, als
reine Werbung für ein Produkt oder eine
Dienstleistung.
Hier ist Content
Trumpf !
Dienstag, der 9. Dezember
Tages-Motto: "Der Zauber des Miteinanders zeigt sich in kleinen Gesten, in denen Freundschaft und Zusammenhalt lebendig werden."

Top Tipps für Network
Marketing!
Tipp 2: Stärke deine persönliche Marke
mehr lesen
Morgen > Tipp 3: Social Media strategisch (Video & Community)
Der 9. Dezember 2025 hat internationale Bedeutung vor allem durch zwei offizielle UN-Gedenk- und Aktionstage: den Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer von Genoziden und zur Genozid-Prävention sowie den Internationalen Anti-Korruptions-Tag. Diese Tage erinnern an historische Meilensteine und fordern globale Maßnahmen zur Verhütung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit
Der Link des Tages: Ein Beispiel für den gestrigen "Tipp 1", das schon seit über 40 Jahren "lebt": Die Basis ist Teebaumöl !
( Jutta P. - HPP - ORGA-Leitung )
Teebaumöl (Melaleuca
alternifolia) ist ein kraftvolles ätherisches Öl mit ausgeprägt
antimikrobiellen und entzündungshemmenden
Eigenschaften.
Ein wahres
Naturprodukt! (s. Wikipedia)
Mittwoch, der 10. Dezember
Tages-Motto: " Die Kunst der Weisheit besteht darin, zu wissen, was man übersehen muss. " ( von Unbekannt )

Top
Tipps für Network Marketing!
Tipp 3: Social Media strategisch (Video & Community)
mehr lesen
Morgen > Tipp 4: Fokus auf Beziehungen statt „Pitchen"
Der 10. Dezember 2025 markiert international vor allem den Internationalen Tag der Menschenrechte (Human Rights Day), einen offiziellen UN-Gedenktag zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948. Dieser Tag sensibilisiert weltweit für bürgerliche, politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und wird durch Kampagnen von Organisationen wie Amnesty International genutzt.
Der Link des Tages: Ein Beispiel für den gestrigen "Tipp 2", zu Ehren unseres Freundes Peter Dubinin, der uns immer in Erinnerung bleibt: Hamsterrad Adieu !
Vor 2 Jahren, am 14.12.2023 verstarb unser geschätzter langjähriger Mentor, Freund und HPP-Mitglied Peter Dubinin. Ihm zu Ehren erinnern wir an sein Wirken mit seinem Ebook "Hamsterrad Adieu"
Donnerstag, der 11. Dezember
Tages-Motto: " Zeit- und Liebesgeschenke sind sicherlich die Grundzutaten für ein wirklich frohes Weihnachtsfest. . " ( gesponsert von Netzwerk-Helden - CEO Michael S. )

Die Story des Tages: An einem kühlen Morgen, wenn der Nebel noch wie ein dünner Schleier über den Feldern lag, stand ein alter Mann am Wegesrand. In seiner rechten Hand ein Spaten, in der linken ein junger Baum, dessen Wurzeln noch zart und verletzlich wirkten. Es war sein tägliches Ritual: Jeden Morgen pflanzte er einen weiteren Baum entlang des schmalen Weges, den Dorfbewohner, Kinder und Reisende nutzten... (Eingereicht von Gertrud H.) > weiter
Der
Rat des Tages: Top Tipps für Network
Marketing!
Tipp 4: Fokus auf Beziehungen statt „Pitchen"
Network Marketing funktioniert nachhaltig nur über Vertrauen, nicht über aggressives Pitchen. Social Selling setzt genau darauf: relevanter Austausch, aktives Zuhören und kontinuierliche Interaktion...
Morgen > Tipp 5: Systematisches Empfehlungs- und Bewertungsmanagement
Der 11. Dezember 2025 hat internationale Bedeutung vor allem durch den Internationalen Tag der Berge (International Mountain Day), einen offiziellen UN-Aktionstag zur Sensibilisierung für die nachhaltige Entwicklung von Bergregionen und deren Herausforderungen wie Klimawandel und Armut.
Der Link des Tages: > Dragonspices ist dort wo die Natur regiert.
DIY Kosmetik wird immer beliebter, denn immer mehr Anwender wollen genau wissen, was in ihren Pflegeprodukten enthalten ist. Der Haken selbstgemachter Cremes und Lotionen ist jedoch die lange Lernkurve. Sofern man keine erprobten Rezepte verwendet, kann es u.U. viel Trial and Error erfordern, bis das Ergebnis den eigenen Vorstellungen entspricht. Bis jetzt! - Deshalb, tue dir was gutes probiere es, weil..
... mit unserem Zauberpulver Emulgator entstehen nur durch Zugabe von Wasser softe Cremes und Lotionen.
Als "Aufgabe des Tages" finde bitte die URL heraus, wo der obige Text in der Webseite Dragonspices zu finden ist 😆 (Hilfe: Nutze auch die KI dazu)
...
Freitag, der 12. Dezember
Tages-Motto: " Wie im Innen, so im Außen. Ich befähige Dich und dadurch deine komplette kleine (Privatleben) und große Infrastruktur (Wirksamkeit/Arbeitswelt)." ( gesponsert von .- Alexander H. )
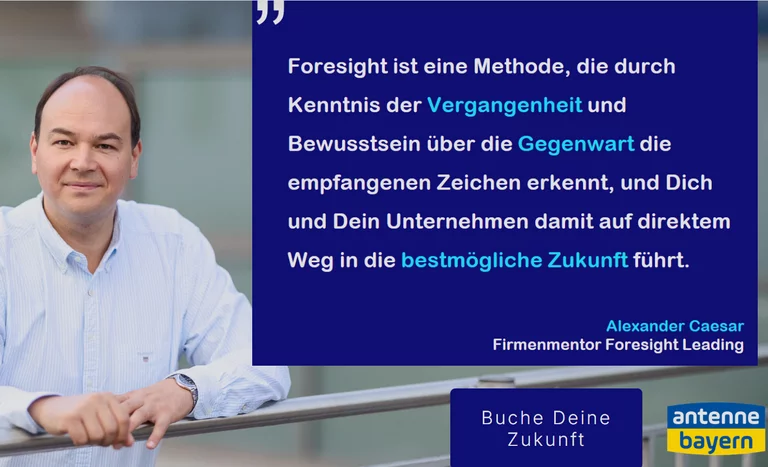
Die Story des Tages: Es war einmal ein treuer Hund namens Bello. Eines Winternachts saß er vor dem Haus seines besten Freundes, dem alten Opa. „Wuff!“, bellte er leise, obwohl Schnee auf seinem Fell tanzte. Das Haus war still, die Lichter aus. „Opa kommt gleich zurück“, dachte Bello und rührte sich nicht. Tage vergingen, bis die Nachbarskinder riefen: „Hilfe!“ Die Feuerwehr kam, fand Opa krank im Bett – und rettete ihn! „Danke, Bello!“, sagte Opa später und kraulte ihn. Von da an wusste jeder: Ein treuer Hund ist der beste Freund der Welt. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. (eingereicht von einem treuen Freund)
Top Tipps für Network
Marketing!
Tipp 5: Systematisches Empfehlungs- (und Bewertungsmanagement ) mehr lesen
Morgen > Tipp 6: Klare Ziele, tägliche Routinen und Kennzahlen
Der 12. Dezember 2025 hat internationale Bedeutung vor allem durch den Internationalen Tag der Neutralität (International Day of Neutrality), einen offiziellen UN-Aktionstag zur Förderung von Neutralitätspolitik und präventiver Diplomatie.
Der Link des Tages: https://best-of-empfehlungs-netzwerk.com/produkte-fuer-gesundheit/gesundheit-und-umwelt/cbd.html
Was ist CBD?
Die Abkürzung CBD steht für Cannabidiol, ein natürliches Phyto-Cannabinoid der Hanfpflanze. Diese findet bereits seit langem traditionellen Einsatz – ob zur Herstellung von Kleidung, als Nahrungsmittel oder auch als Medizin. Bislang konnten mehr als 500 natürliche Bestandteile in der Hanfpflanze bestimmt werden. Davon etwa 100 Cannabinoide, mit jeweils unterschiedlichen Eigenschaften. CBD gehört neben THC zu den bekanntesten Wirkstoffen. Im Vergleich zu THC definiert sich CBD über seine nicht psychoaktive Wirkung: Stimmung, Wahrnehmung und Bewusstsein werden durch die Einnahme nicht beeinflusst.
Erzähle etwas über Deine Erfahrung mit dieser Pflanze - trage es in das Kommentarfeld ein...
Samstag, der 13. Dezember
Tages-Motto: " Gott schenkt dir das Gesicht, lächeln musst du selber. (Indisches Sprichwort)

Die Story des
Tages: 🌟 Manchmal sind es die Klänge unserer Kindheit,
die uns am tiefsten berühren. In vielen Familien gibt es
Traditionen, die mehr sind als nur Rituale — sie sind
Herzensanker.
Vielleicht erinnerst du dich auch an einen dieser besonderen
Abende:
weiter
lesen
(eingebracht von Charly S.)
Top Tipps für Network
Marketing!
Tipp 6: Klare Ziele, tägliche Routinen und Kennzahlen
Marketing ist ein Vertriebsgeschäft; ohne konkrete Ziele, Tagesroutinen und Kennzahlen bleibt es bei Zufall. Wer es professionell betreibt, arbeitet mit klaren Aktivitäten, Trackingsystemen und regelmäßiger Reflexion... mehr lesen
Morgen > Tipp 7: Weiterbildung, Ethik und Langfristdenken
Der 13. Dezember 2025 ist kein internationaler UN-Gedenktag und in Deutschland weder gesetzlicher Feiertag noch zentraler nationaler Gedenktag. In einigen überwiegend christlich geprägten Ländern (z.B. Skandinavien) wird um dieses Datum traditionell das Lucia‑Fest als Lichterfest in der Adventszeit begangen, hat aber keinen offiziellen UN‑ oder bundesweiten Status
Der Link des Tages: Alles zum Thema GOLD
Was ist Gold? Gold ist für Investoren ein Sachwert, der vor allem als langfristiger Wertspeicher und Absicherung gegen Krisen, Inflation und Währungsrisiken gesehen wird. Es erzeugt keine laufenden Erträge wie Zinsen oder Dividenden, sodass die Rendite ausschließlich von Preissteigerungen abhängt und der Kurs teils stark schwankt. Im Portfolio eignet sich Gold deshalb eher als Beimischung in begrenzter Höhe (oft werden etwa 5–10% des Vermögens genannt), um Risiken zu streuen und in Phasen starker Unsicherheit einen Gegenpol zu Aktien und Anleihen zu bilden.
Sonntag, der 14. Dezember
Tages-Motto: " Dem Ideal immer ein Stück näher" ( GK - HPP )

Top Tipps für Network
Marketing!
Tipp 7: Weiterbildung, Ethik & Langfristdenken
Seriöses Network Marketing ist ein erlernbarer Beruf mit klaren Skills: Kommunikation, Vertrieb, digitale Sichtbarkeit, Teamführung und vor allem Ethik. Wer langfristig denkt, investiert konsequent in Weiterbildung und ein klares Wertefundament.
mehr lesen
Morgen > Tipp 8: Zusammenfassung
Der 14. Dezember 2025 ist in Indien „National Energy Conservation Day“, der für einen bewussten und effizienten Umgang mit Energie sensibilisieren soll; daneben existieren mehrere vor allem inoffizielle Themen- und Aktionstage (z.B. Monkey Day, World Choral Day).
Der Musikwunsch des Tages: (Bitte komplett genießen.. !) - ganz spezieller Wunsch von Charly S.
Der Witz des Tages: Hast du deiner Frau schon mal die Meinung gesagt?" "Klar. Soll ich dir die Narbe zeigen?
Wer / Was ist HPP? - (Hebel-Partner-Projekte) ist eine 2005 gegründete Networker-Gemeinschaft, die bis heute wirkt und deren Ziel ist, ein mittel- bis langfristiges multiples-mehrfacheinkommen zu erwirtschaften und es nach einem Leistungseinbringenden System zu verteilen.
Das E.NW ist eine im Jahre 2025 entstandener Verbund, der sich auf Marketer unterschiedlicher Schwerpunkte ausrichtet und deren Produkte und deren Empfehlung einem speziellen Abrechnungssystem folgen. ( s. Folge-Infos )
Erzähle etwas über Deine Erfahrung mit HPP, speziell mit dem Empfehlungs-Netzwerk (In einer Skala von 0 ( kenne es gar nicht ) - 1 ( sehr gut ) - 5 ( sehr schlecht ) .. - trage es in das Kommentarfeld ein...
Fortsetzung vom 8. Dezember:
Tipp 1: Seriöses Unternehmen & Produkt
Ein seriöses Network-Marketing-Unternehmen stellt immer ein marktfähiges Produkt in den Mittelpunkt – nicht die bloße Rekrutierung neuer Partner. Warnsignale sind z.B. hohe Einstiegspakete, unrealistische Einkommensversprechen, unklare Firmenstrukturen und Druck, „jetzt sofort“ zu unterschreiben.
Konkrete Prüfkriterien:
-
Verbraucherschutz & Behörden: Das Europäische Verbraucherzentrum warnt explizit vor MLM‑Systemen, bei denen der Verdienst primär aus Rekrutierung, nicht aus Produktverkauf kommt. URL: https://www.evz.de
-
Staatliche Beratung: Die Bayerische Verbraucherzentrale erklärt leicht verständlich, welche Merkmale seriöses Multi‑Level‑Marketing von illegalen Schneeballsystemen unterscheiden (Fokus auf Produktverkauf, keine hohen Vorleistungen, Rückgaberechte). URL: https://www.vis.bayern.de/recht/werbung_recht/multi_level_marketing.htm
-
Unternehmerlexikon: Lexware erläutert MLM als Sonderform des Direktvertriebs und grenzt seriöse Modelle von unseriösen ab (Transparenz, Produktfokus, kein Kaufzwang von Vorräten). URL: https://www.lexware.de/wissen/unternehmerlexikon/mlm
Fortsetzung vom 9. Dezember:
Tipp 2: Stärke deine persönliche Marke
Im Network Marketing kaufen Menschen selten „die Firma“, sondern die Person: Expertise, Glaubwürdigkeit und Haltung sind entscheidend. Eine professionelle Personal Brand macht dich zur vertrauenswürdigen Ansprechperson und reduziert Widerstände gegen das Geschäftsmodell.
Praxisideen für deine Marke:
-
Social-Selling-Leitfäden wie von Hootsuite empfehlen eine klare, professionelle Online-Präsenz mit wiedererkennbarer Positionierung (z.B. „ganzheitliche Gesundheit im Alltag“, „Nebenberuflicher Vermögensaufbau für Mütter“). URL: https://blog.hootsuite.com/de/social-selling-richtig-machen
-
Die Social Media Akademie zeigt, wie ein Profil (z.B. auf LinkedIn) für Social Selling optimiert wird: professionelles Foto, klare Headline mit Nutzenversprechen, verständige Profil-Story, und Inhalte, die Probleme der Zielgruppe adressieren. URL: https://www.socialmediaakademie.de/blog/social-selling-im-vertrieb-ein-praxisleitfaden
Fortsetzung vom 10. Dezember:
Tipp 3: Social Media strategisch (Video & Community)
Social Media ist im Network Marketing heute der wichtigste Hebel für Sichtbarkeit und Beziehungsaufbau. Entscheidend ist Social Selling: Mehrwert und Austausch statt „Spam mit Links“.
Wichtige Elemente:
-
Leitfäden zu Social Selling betonen vier Säulen: professionelle Marke, relevanter Content, Aufbau eines passenden Netzwerks und aktive Pflege der Beziehungen.
-
Praxisleitfäden zeigen, dass Social Selling deutlich bessere Vertriebsergebnisse bringt als reine Kaltakquise, wenn regelmäßig hilfreiche Inhalte geteilt und persönliche Interaktionen gepflegt werden.
Konkrete Praxisbeispiele (mit URLs als Inspiration):
-
Content-Strategie: Der Artikel zeigt, wie Content-Pläne für Social Selling aussehen können (Bildposts, Kurzvideos, Stories, Livestreams – jeweils mit klarem Nutzen für die Zielgruppe). URL:https://blog.hootsuite.com/de/social-selling-richtig-machen/
-
Profil-Check & Checkliste: Die Social Media Akademie liefert eine Checkliste für Social-Selling-Profile, die du 1:1 für dein Network-Marketing-Profil adaptieren kannst. URL:https://www.socialmediaakademie.de/blog/social-selling-im-vertrieb-ein-praxisleitfaden/
Konkrete Video- und Community‑Ideen:
-
Wöchentliche Kurzvideos (60–120 Sekunden) zu einem Problem deiner Zielgruppe, inkl. Mini-Tipp, ohne Produktnennung in jedem Clip (erst Vertrauen, dann Angebot).
-
Geschlossene Facebook‑Gruppe oder LinkedIn‑Community mit klarer Positionierung (z.B. „Mehr Energie im Schichtdienst“), in der du regelmäßig Live‑Q&As, Experteninterviews und Erfahrungsrunden anbietest.
Fortsetzung (Teil2) vom 10. Dezember:
INHALT Ebook "Hamsterrad Adieu" (von Peter Dubinin)
- Führungsqualität im Network-Marketing
- Mindset* im Network-Marketing (*Einstellung
- Network-Marketing – Segen oder Fluch
- Was sagen prominente Menschen zu Network-Marketing
- Trends und Zukunft im Vertrieb des nächsten Jahrtausends
- Die Erfolgsvariablen im Kooperative- und Network-Marketing
- Entwickeln Sie Ihre Fähigkeiten zum Wohlstand
- Gedanken, Motive, Entschlüsse und Handlungen
- Aus neuen Ideen den größten Nutzen ziehen
- Die DREI Entwicklungsstufen eines neuen Geschäftspartners
- Übung macht nicht den Meister, es macht „beständig“
- Erzeugen Sie vor allem eine treibende Kraft – MOMENTUM
- Entwickeln Sie Ihr MOMENTUM
- Starten und erhalten Sie Ihr MOMENTUM
- Tragen Sie Ihr MOMENTUM weiter
- Ein Tag auf einmal, ein Stein nach dem anderen
- Alle Ablenkungen sind gleich
- Übernehmen Sie die volle Verantwortung
- Wissen wofür Sie bezahlt werden
- Lassen Sie die Leute wissen, in welchem Geschäft sie sind
- Halten Sie Ausschau nach unzufriedenen Menschen
- Unzufrieden mit dem Einkommen oder Vermögen
- Unzufrieden mit jetziger Anstellung oder Karriere
- Unzufrieden mit dem Mangel an persönlicher Herausforderung
- Unzufrieden mit dem Mangel an Freude im Leben
- Verpacken Sie Ihr Geschäft in einer Präsentation
- Wahnsinnig begeistert und zutiefst ernst
- Entscheiden Sie nicht für andere Menschen
- Bereiten Sie die Leute vor, eine Entscheidung treffen zu müssen
- Bereiten Sie sich selbst für jede Präsentation vor
- Die Kunst erfolgreich „Selbständig“ zu sein
- Die kostspielige Angewohnheit - sich selbst zu belügen
- Die kostspielige Angewohnheit - der Aufschieberittis
- Die kostspielige Angewohnheit – sich unehrgeizige Ziele zu setzen
- Die kostspielige Angewohnheit – Probleme zu vermeiden
- Der 5-Stufenplan zur Problemlösung
- Wie Sie Ihre Ergebnisse ändern können
- Wie man Frustrations Barrieren überwindet
- Lernen Sie mit den Karten zu spielen, die Sie bekommen
- Strategie und Taktik
- Führen durch Beispiel
- Die vier Phasen des „Managements“
- Achten Sie immer auf Ihre Kontrollinstrumente
- Ernsthafte Ergebnisse bekommt man „nie“ sofort
- Leading – Sie müssen die Richtung angeben
- Die 72-Stunden Regel
- Das System duplizieren
- Sehen andere das Geschäft, das SIE sehen?
Fortsetzung vom 11. Dezember:
Tipp 4: Fokus auf Beziehungen statt „Pitchen"
Beziehungsorientierte Ansätze:
-
Social-Selling-Konzepte setzen den persönlichen Kontakt und den Aufbau langfristiger Beziehungen über schnelle Abschlüsse. Dazu gehören Kommentare, persönliche Nachrichten, individuelle Fragen und das ernsthafte Interesse an der Lebenssituation des Gegenübers.
-
Praxisleitfäden empfehlen, zuerst echte Gespräche zu führen, ihre Situation zu verstehen und erst dann ein Angebot vorzuschlagen, das auch wirklich passt.
Konkrete Beispiele:
-
Auf LinkedIn nimmst du Kontakt auf, reagierst über einige Tage auf Beiträge, stellst Rückfragen und bietest erst danach ein kurzes, unverbindliches Kennenlerngespräch an – ohne sofort über „ein Mega-Business“ zu sprechen.
-
In deiner Community veranstaltest du regelmäßige Live-Sessions, in denen du Wissen teilst (z.B. gesundheitliche Aufklärung, Business-Skills) und Interessenten sich ohne Kaufdruck informieren können
Fortsetzung vom 11. Dezember:
Die Story des Tages:
Eines Tages blieb sein
Nachbar stehen, lehnte sich neugierig an den Zaun und
fragte:
„Sag mal, warum pflanzt du
jeden Tag Bäume? Du bist alt – du wirst nie im Schatten dieser
Bäume sitzen.“
Der alte Mann richtete sich
langsam auf, wischte sich die Erde von den Händen und lächelte.
In seinen Augen lag etwas Ruhiges, Tiefes.
„Genau deshalb“, antwortete
er leise. „Jemand anderes wird es tun.“
Der Nachbar schüttelte den Kopf, halb verwundert, halb berührt. Für ihn war es unlogisch, so viel Zeit und Kraft in etwas zu stecken, von dem man selbst nichts haben würde. Für den alten Mann war es das Natürlichste der Welt. Er war überzeugt: Das, was wir heute säen, muss nicht immer für uns selbst sein.
Die Jahre vergingen. Der alte Mann wurde seltener am Weg gesehen, sein Schritt langsamer, sein Rücken gebeugter. Doch die Bäume, die er gepflanzt hatte, wuchsen still heran. Ihre Wurzeln griffen tief in die Erde, ihre Kronen breiteten sich aus, und aus den zarten Pflänzchen wurden starke, schützende Riesen.
Eines Sommers liefen Kinder lachend den Weg entlang. Sie jagten sich zwischen den Schatten der Bäume, lehnten sich an die rauen Stämme und erzählten sich Geheimnisse im Flüsterton. An heißen Tagen legten sich Reisende dankbar in den Schatten, tranken Wasser, ruhten ihre müden Füße aus und blickten dankbar in das Blätterdach über ihnen.
Niemand kannte den Namen des Mannes. Es gab keinen Stein mit Inschrift, keine Tafel, kein Foto. Kein Ruhm, keine große Geschichte. Aber in jedem kühlen Schatten, in jedem Kinderlachen und in jedem erleichterten Seufzer eines Reisenden lebte seine Tat weiter.
Die eigentliche Spur, die er hinterlassen hatte, war unsichtbar – und doch deutlich spürbar: in der Erleichterung, im Lächeln, in dem leisen Gefühl: „Zum Glück steht hier dieser Baum.“
Die Story des Tages: Nicht alles, was wir tun, ist für uns bestimmt. Manches ist ein stilles Geschenk an Menschen, die wir nie kennenlernen werden – und an eine Zukunft, in der unser Name längst vergessen ist, aber unsere Taten noch wirken.
Fortsetzung vom 12. Dezember:
Tipp 5: Systematische Empfehlungen und Bewertungen
Wichtige Elemente:
-
Seriöse Network-Unternehmen legen Wert auf transparente Kommunikation und faire Behandlung von Vertriebspartnern und Kunden; dazu gehören auch offen einsehbare, echte Erfahrungsberichte.
-
Ethikorientierte Experten empfehlen, mit realistischen Ergebnissen zu arbeiten, keine übertriebenen „Vorher-Nachher-Wunder“ zu versprechen und auch Grenzen der Produkte ehrlich zu benennen.
Konkrete Umsetzungsideen:
-
Google‑Bewertungen: Bitte zufriedene Kunden aktiv um kurze, ehrliche Rezensionen zu deinem Service (z.B. „Beratung zur Vitalität im Alltag“), nicht nur zum Produkt.
-
Referenzen auf einer externen Seite (Blog, Landingpage, LinkedIn‑Empfehlungen), die auf deine Beratungskompetenz und Begleitung eingehen, statt auf schnellen Reichtum.
-
In persönlichen Gesprächen: Zufriedenheitsumfragen nach 4–6 Wochen und die Frage, ob es im eigenen Umfeld jemanden gibt, der von einem kostenlosen Erstgespräch profitieren könnte (Empfehlung statt Druck).
Fortsetzung vom 13. Dezember:
Tipp 6: Klare Ziele, tägliche Routinen und Kennzahlen
Mögliche Kennzahlen und Routinen:
-
Social-Selling-Praxisleitfäden empfehlen, Social-Media-Aktivitäten messbar zu machen: Anzahl qualifizierter Kontakte, Gespräche pro Woche, Termine, Abschlüsse und Folgekäufe.
-
Persönlichkeitsentwicklungs-Artikel für Networker betonen langfristige Perspektiven von 5–10 Jahren und tägliche Aktivitäten, statt auf schnelle Erfolge zu hoffen.
Konkrete Beispiele:
-
Tägliche Routine: 30 Minuten Content posten/kommentieren, 5–10 neue relevante Kontakte, 3–5 persönliche Nachrichten, 1–2 Termine vereinbaren – und alles in einer einfachen Excel-Liste tracken.
-
Monatsziele: z.B. Anzahl neuer Kunden, Anzahl aktiver Teampartner, Social-Media-Reichweite – jeweils mit einem Plan, welche Aktivitäten diese Zahlen beeinflussen (z.B. zusätzliche Lives, Workshops)
Fortsetzung vom 13. Dezember:
Die Story des Tages: (erzählt von Charly S. - Halifax, Canada)
... wenn sich das Wohnzimmer
füllte, Kerzen brannten, Stimmen sich vereinten und die Musik
den Raum in etwas Heiliges verwandelte.
In unserer Familie
war es das Weihnachtskonzert.
Wir Kinder spielten Klavier,
die Erwachsenen sangen, und wir luden sogar die Nachbarn
ein.
Es war nicht perfekt — aber
es war echt.
Und gerade dadurch war es
unvergesslich.
Dieses Miteinander, dieses
Teilen von Musik und Wärme, hat eine Tiefe, die man später im
Leben erst richtig versteht.
Solche Momente zeigen uns, wie wichtig Gemeinschaft ist — und wie sehr Musik Herzen verbindet.
Fortsetzung vom 14. Dezember:
Tipp 7: Weiterbildung, Ethik & Langfristdenken
Relevante Inhalte:
-
Fachartikel zu Ethik im Network Marketing betonen Transparenz, Fairness, Verantwortung und nachhaltige Ausbildung; nur so entsteht langfristiges Vertrauen in die Branche. URL:https://www.urs-hengartner.com/ethik-im-network-marketing.htmlurs-hengartner
-
Podcasts und Inhalte zu „Nachhaltigkeit und Ethik im Network Marketing“ zeigen, wie systematische Schulungs- und Ausbildungskonzepte aufgebaut werden, um über Jahrzehnte ein stabiles Business zu ermöglichen. URL:https://www.youtube.com/watch?v=E4QqN_0Mk-0youtube
-
Persönlichkeitsentwicklungsartikel für Networker ermutigen, den Fokus auf langfristiges Wachstum, Mindset-Arbeit und Teamcoaching zu legen, statt auf kurzfristige Boni. URL:https://www.chidealer.at/network-marketing/persoenlichkeitsentwicklung-im-network-business-nicht-jammern-sondern-in-das-tun-kommenchidealer
Konkrete Praxisansätze:
-
Teilnahme an vertriebsnahen Social-Selling-Trainings (z.B. Strategieleitfäden wie von Hootsuite oder Social Media Akademie) und gleichzeitige Reflexion, wie sich diese Inhalte ethisch sauber im eigenen Network-Business einsetzen lassen.hootsuite+1
-
Erarbeitung eines persönlichen Ethik-Codes: keine übertriebenen Versprechen, klare Transparenz zu Verdienstmöglichkeiten, respektvoller Umgang mit Nein-Sagern, kein Druck auf Freunde/Familie.